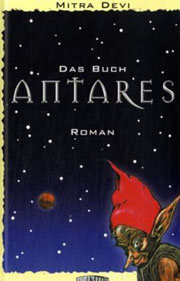In der buddhistischen Lehre spielt die Anhaftung eine zentrale Rolle. Sie verursacht Leiden – das Nirwana, der radikale Ausweg aus dem Leiden, ist das Ziel des Buddhisten.
Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass alles vergänglich ist, jeder Gegenstand, jedes Lebewesen, aber auch jede Situation, jeder Zustand. Solange wir etwas Geliebtes besitzen, sind wir glücklich. Doch diesem Besitz wohnt die Möglichkeit, ja die Sicherheit inne, dass wir ihn irgendwann verlieren: Ein Gegenstand, an dem wir hängen, kommt uns abhanden oder geht kaputt, ein Mensch, den wir lieben, stirbt oder verlässt uns (oft empfinden wir ja schon kurzzeitige Trennungen als schmerzhaft). Auch haben wir alle schon erlebt, dass wir ein beglückendes Ereignis, beispielsweise der Besuch eines schönen Ortes oder eine angenehme Situation, wiederholen wollten, aber wie oft wurden wir dabei enttäuscht, weil es nicht mehr wie das erste Mal war!
Wir hängen an den Dingen, an den Menschen, an den Zuständen. Meistens sind wir nicht in der Lage, alles wie in einem Film zu betrachten, der ein, zwei Stunden dauert, zu Ende geht – und das wars! Er ist einfach fertig und wir leiden nicht deswegen. Im wirklichen Leben fällt uns das Loslassen enorm schwer; schon eine kleine Veränderung, die uns nicht passt, kann uns Traurigkeit und Schmerz verursachen.
Die Lösung kann nicht darin bestehen, überhaupt nichts mehr zu besitzen, keinen Menschen mehr zu lieben, keine Freude mehr an Schönem zu empfinden, da grundsätzlich nicht der Besitz und der Genuss das Leiden verursachen, sondern nur unsere Anhaftung daran.
Es gibt kein anderes Mittel gegen unsere Anhaftung, als das Loslassen ständig zu üben; ein grundlegender Gleichmut und das Vertrauen, dass alles, was uns geschieht, gut für uns ist und uns auf unserem Weg weiterführt, sind dabei die Eckpfeiler.
Mit den materiellen Dingen gelingt uns das schon bald ziemlich gut. Wir verlieren unser Halskettchen, das Portemonnaie mit viel Geld wird uns gestohlen, ein geschätzter Gegenstand geht kaputt: In diesen Fällen schaffen wir es meistens, den Verlust anzunehmen und den Dingen nicht nachzutrauern. Schon schwieriger ist es beim Davonlaufen der Katze oder dem Tod des Hundes. Und völlig frei von Leiden sind wir wohl nie, wenn ein geliebter Mensch von uns geht…
Ist ein Verlust bereits eingetreten, hindert der Schmerz uns daran, uns mit der Anhaftung auseinander zu setzen; dann sind wir nur noch damit beschäftigt, das Leiden zu verarbeiten. Die Schule gegen die Anhaftung sollte beginnen, wenn die Gegenstände oder Menschen noch bei uns sind: Solange wir sie „besitzen“, müssen wir lernen, uns an ihnen zu erfreuen, ohne an ihnen zu hängen und ohne ihren Verlust zu fürchten.
Sobald wir allerdings versuchen, innerlich, gefühlsmässig einen Menschen, der immer noch bei uns ist (den Partner, die Eltern, ein Kind), loszulassen und die Anhaftung abzubauen, meinen wir, eine gewisse Gleichgültigkeit und Leere zu empfinden, und es kommt uns vor, als liebten wir diesen Menschen nicht mehr. Unser Ego setzt nämlich Liebe mit Besitz gleich: Wenn es nicht mehr besitzen kann, so liebt es auch nicht mehr. In diesem Moment dürfen wir nicht aufgeben, nicht denken: „Besser mit Anhaftung lieben als gar nicht“. Es gilt diese Leere eine Weile auszuhalten: Wenn etwas wegfällt, entsteht ein Loch – nennen wir es lieber positiv „freier Raum“ –, der sich erst wieder füllen muss, was eine Zeitlang dauern mag. Gefüllt wird die von der egoischen Liebe hinterlassene Lücke mit der Liebe der Seele, dieser bedingungslosen Liebe, die nichts erwartet und nichts fordert – nicht besitzt, nicht anhaftet. Diesen freigewordenen Raum wieder zu besetzen ist zugegebenermassen ein langwieriges, hartes Stück Arbeit, das ständigen Übens in den Alltagssituationen bedarf: Die vermeintliche Gleichgültigkeit wird dabei in Fürsorge umgewandelt, die Distanz in Respekt – und langsam fühlen wir die wahre Liebe in uns wachsen.
Je früher wir mit den Bemühungen beginnen, die Anhaftung loszuwerden, desto eher sind wir dann bereit, wenn der geliebte Mensch uns verloren geht. Kommt es eines Tages zur Trennung – dazu kommt es unweigerlich, spätestens durch den Tod –, so werden wir dem Verlust vielleicht noch nicht völlig schmerzfrei, zumindest aber mit einem gewissen Mass an Gleichmut begegnen können.
Artikel teilen auf: